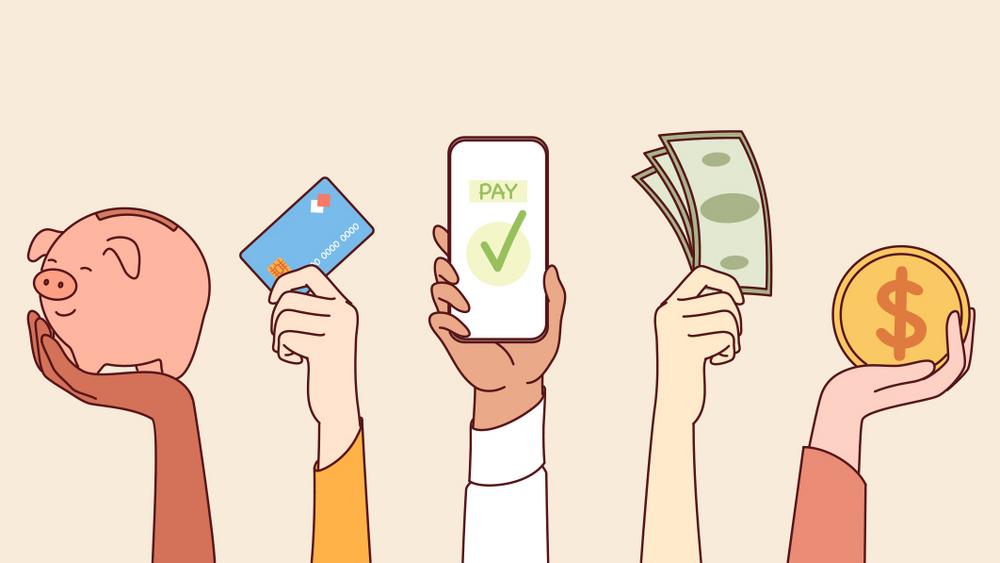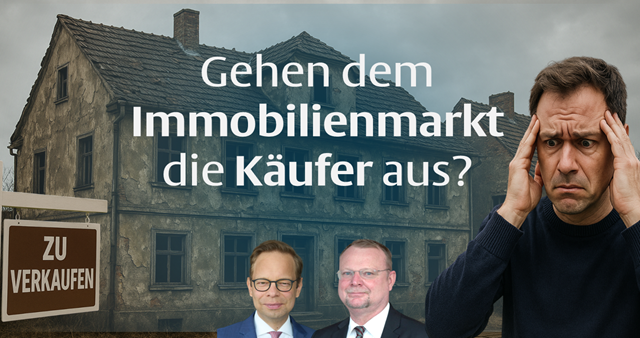KOMMENTAR. Die EZB dürfte bereitstehen, die Entstehung einer neuen Eurokrise bereits im Keim zu ersticken. Zudem dürfte die Politik der Schuldenverlagerung auf die europäische Ebene forciert werden.
Der Versuch des französischen Ministerpräsidenten François Bayrou, den Staatshaushalt Frankreichs zu konsolidieren und 44 Mrd. Euro einzusparen, ist gescheitert. Und Bayrou hat nach monatelangen Budgetverhandlungen wohl deshalb die Vertrauensfrage gestellt, die er mit 194 zu 394 Stimmen haushoch verloren hat, weil er selbst nicht mehr an eine verantwortbare Lösung glaubte. Seine Minderheitsregierung konnte im Parlament weder von der parlamentarischen Linken noch von der parlamentarischen Rechten ausreichend Abgeordnete für die Einsparung von 44 Mrd. Euro überzeugen. Der rechte Rassemblement National (RN) und die linke Volksfront sind sich darin einig, weitgehende Einsparungen im französischen Staatshaushalt abzulehnen. Zusammen haben sie die Mehrheit in der Nationalversammlung. Der größte Verlierer ist jedoch nicht Bayrou, der sich mit der Vertrauensfrage selbst aus einer schwierigen politischen Situation herausgenommen, aber Frankreichs Probleme noch weiter vergrößert hat. Der größte Verlierer ist Staatspräsident Emmanuel Macron.
Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2017 hat Emmanuel Macron zwar wichtige wirtschafts- und sozialpolitische Reformen durchsetzen können, er hat die französische Staatsverschuldung jedoch nie in den Griff bekommen. Die französische Staatsverschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von 98 Prozent im Jahr seines Amtsantritts 2017 auf 113 Prozent im Jahr 2024 und soll laut Prognosen bis 2030 auf 128 Prozent ansteigen.1 Deshalb hat Präsident Macron während seiner gesamten Amtszeit versucht, sein Budgetbeschränkungsproblem auf die europäische Ebene zu verlagern, sei es durch Befürwortung einer lockeren Geldpolitik der EZB und insbesondere der EZB-Anleihekaufprogramme, sei es durch die Befürwortung neuer Schuldentöpfe auf EU-Ebene. Angesichts der weiter anwachsenden haushaltspolitischen Probleme in Frankreich dürfte Macron diese Europapolitik mit noch mehr Nachdruck fortsetzen.
Fraglich ist jedoch, ob diese Politik der Verlagerung auf die europäische Ebene innenpolitisch bewirkt, dass neue Mehrheiten in der Mitte entstehen und nicht die politischen Ränder weiter gestärkt werden. Denn Emmanuel Macron hat sich bezüglich seiner durchaus erfolgreichen Reformpolitik im Widerspruch der französischen politischen Kultur verheddert.
In Frankreich hat sich über Generationen eine politische Kultur entwickelt, in welcher man einerseits zu aggressiven Massenprotesten und militantem Widerstand gegen Reformvorhaben des Staates neigt. Dazu kommt, dass politische Streiks in Frankreich erlaubt sind. Andererseits wird in Frankreich über alle Parteigrenzen hinweg und in allen Bevölkerungsschichten der Primat der Politik über Wirtschaft und Gesellschaft vertreten und die Allzuständigkeit des Zentralstaates gefordert. Die Überforderung des Staates ist deshalb systematisch vorprogrammiert. Der Staat soll es richten. Aber wenn er Verkrustungen und Besitzstände aufbrechen will, treiben ihn militante Proteste bis hin zu politischen Streiks in die Defensive. Politische Polarisierung durch Problemverschleppung ist die Folge.
Der heutige Staatspräsident Emmanuel Macron legte im Frühjahr 2017 ein Wahlprogramm mit konsequenten Reformvorhaben (Arbeitsmarkt, Rentenpolitik, Steuern- und Abgaben) vor, vermied jedoch konkrete Festlegungen, welche Kosten damit für wen verbunden sind. Macron richtete seine Wahlkampfstrategie also konsequent an der skizzierten politisch-kulturellen Widersprüchlichkeit Frankreichs aus und vermittelte den Eindruck, nichts an der Komfortzone der staatlichen Fürsorge und des Wohlstaatsstaates ändern zu wollen. Am 7. Mai 2017 wurde Emmanuel Macron zum neuen Präsidenten Frankreichs gewählt. Und bei den Parlamentswahlen im Juni 2017 errang sein Wahlbündnis die absolute Mehrheit an Sitzen.
Seine Wahlkampfstrategie ging auf, legte jedoch bereits die Saat für sein späteres Scheitern und für das wachsende Staatsschuldenproblem Frankreichs. Macrons Reformen waren mit Kosten verbunden, die unter anderem zu den Gelbwesten-Protesten führten, die sich vom Herbst 2018 bis Frühjahr 2019 gegen die geplante Finanzierung der Energiewende durch höhere Verbrauchssteuern auf fossile Energie wendeten. Im Verlauf forderten die Gelbwesten eine Erhöhung des Mindestlohns und der Renten. Nachhaltige und effektive Einsparungen im Staatshaushalt, um das Anwachsen der Staatsschuldenquote zu verhindern oder gar die Staatsschuldenquote zu senken, erschienen immer weniger opportun. 2020 kam dann noch die Corona-Pandemie und als Folge der schuldenfinanzierten Corona-Hilfspakete baute sich Inflation auf.
Vor der Wahl zur Nationalversammlung im Juni 2022 bedienten nun Marine Le Pen auf der Rechten und Jean-Luc Mélenchon auf der Linken die Widersprüchlichkeit der französischen politischen Kultur, indem sie das Thema Inflation besetzten, über wirksame Maßnahmen gegen die Inflation aber schwiegen. Denn die von ihnen propagierten Ausgabenprogramme für die umworbene Wählerklientel sollten durch neue Staatsschulden finanziert werden.
Emmanuel Macron ist es weder 2022 noch vor den Parlamentswahlen 2024 und seitdem erst recht nicht gelungen, diesen Grundwiderspruch in den Positionen zur Inflation von Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon glaubwürdig zu entkräften. Erstens sind in der Amtszeit von Emmanuel Macron die Staatsschulden Frankreichs auf über 110 Prozent des BIP gestiegen. Wenn Macron ein Programm zur Konsolidierung der Staatsschulden auf 60 Prozent des BIP, wie von den europäischen Stabilitätskriterien gefordert, vorgeschlagen hätte, was mit weitreichenden Einschnitten im französischen Staatshaushalt verbunden wäre, dann hätten die rechten und linken Populisten noch mehr Zulauf erhalten.
Zweitens kann Macron diese Forderung gar nicht glaubwürdig vertreten, da seine gesamte Europapolitik der letzten acht Jahre darauf ausgerichtet war, die Stabilitätskriterien der Europäischen Verträge auszuhöhlen und neue Staatsschuldentöpfe auf europäischer Ebene zu etablieren. Das heißt, Emmanuel Macron hätte bei Inflation und Staatsschulden nur dann Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon etwas entgegenzusetzen gehabt, wenn er seine eigene Europapolitik korrigiert hätte. Dazu war und ist Macron jedoch nicht bereit und dazu wird er auch in seiner restlichen Amtszeit nicht bereit sein.
Dass aus der andauernden französischen Regierungskrise bereits eine neue Eurokrise wie 2012 folgt, ist eher unwahrscheinlich. Denn die EZB dürfte bereitstehen, den Beginn jeder Krise schon im Keim zu ersticken.
Ob zur Unterstützung Frankreichs das Transmission Protection Instrument (TPI)2 der EZB aktiviert wird, bleibt abzuwarten. Die TPI-Aktivierungsbedingungen stehen dem eigentlich entgegen. Allerdings standen die No-Bail-out-Klausel und das Verbot von monetärer Staatsfinanzierung in den Europäischen Verträgen auch vielen Maßnahmen seit der Griechenlandkrise entgegen. Vielleicht erfindet man auch ein neues Hilfsinstrument.
Vermutlich wird vorab die Politik der Schuldenverlagerung auf die europäische Ebene forciert werden. Zum einen kann man diesbezüglich an das Gutachten zum Zustand der EU des ehemaligen EZB-Präsidenten und ehemaligen italienischen Premierministers Mario Draghi anknüpfen:
“Es ist eine gewisse gemeinsame Finanzierung von Investitionen auf EU-Ebene erforderlich, um das Produktivitätswachstum zu maximieren und andere europäische öffentliche Güter zu finanzieren (…) Die Ausgabe gemeinsamer sicherer Anlagen zur Finanzierung gemeinsamer Investitionsvorhaben könnte nach bestehenden Vorlagen erfolgen, müsste jedoch mit allen Garantien einhergehen, die ein solcher grundlegender Schritt beinhalten würde. Für die Verwendung einer gemeinsamen sicheren Anlage gibt es einen bewährten Präzedenzfall bei der Finanzierung des Programms NextGenerationEU.“3
Zum anderen ist die Auflage eines EU-Verteidigungsfonds nicht unwahrscheinlich, der dann durch Eurobonds finanziert wird, die man Kriegsanleihen oder Verteidigungsanleihen nennen könnte.
Dass durch derartige Maßnahmen der Euro als international nachgefragte Währung attraktiver wird und dadurch die Verschuldungsspielräume der Euro-Staaten erweitert werden, ist jedoch unwahrscheinlich. Sollte Deutschland darüber hinaus seine Schuldenbremse auf Dauer abschaffen oder weiter schleifen, dann dürfte der größte Stabilitätsanker des Euro in Form relativ solider deutscher Staatsfinanzen schrumpfen, was die Stabilität des Euro schwächen dürfte.
Trotz der möglichen geldpolitischen Krisenbekämpfungsmaßnahmen der EZB und der fiskalpolitischen Verlagerung von Staatsschulden auf die EU-Ebene ist der Ausbruch einer neuen Eurokrise nicht auf Dauer auszuschließen. Wenn die Politik der Schuldenverlagerung auf die europäische Ebene weiter forciert wird, was sehr wahrscheinlich ist, dann könnten sich die Interessenkonflikte zwischen den Euro-Nordländern und den Euro-Südländern verstärken. Nicht nur in Frankreich, sondern in vielen anderen europäischen Staaten haben die Populisten von links und rechts ohnehin ungebrochenen Zulauf. Das Schuldenproblem könnte diesen Zulauf weiter verstärken, weil entweder durch erhöhte Zinslasten die Ausgabenspielräume in vielen EU-Staaten weiter sinken oder durch Eurobonds neue EU-Schuldentöpfe finanziert werden müssen oder weil geldpolitische Maßnahmen zur Senkung dieser Zinslasten und damit letztlich durch monetäre Staatsfinanzierung Vermögenspreis- oder Verbraucherpreisinflation erzeugen. In vielen EU-Ländern könnte die Bereitschaft sinken, diese Kosten für andere EU-Länder mitzutragen und als Haftungsanker zu dienen. Weit über die französische Regierungskrise hinaus könnten sich also politische Dynamiken entwickeln, welche den Haftungsanker (Collateral) der finanzpolitisch relativ stabilen Euro-Nordländer für die Euro-Südländer zunehmend in Frage stellen.
Das heißt, dass die Staatsschulden nicht nur in Frankreich dauerhafte Regierungskrisen erzeugen. In der gesamten EU können – qua Polarisierung durch Problemverschleppung – Staatsschulden destabilisierend wirken. Und die französische Regierungskrise könnte deshalb erst der Anfang sein. Ceterum censeo: Das Problem sind die Staatsschulden. Und durch die Verlagerung auf die europäische Ebene wird letztlich nichts gewonnen.4
1 Siehe statista: Frankreich: Staatsverschuldung von 1980 bis 2023 und Prognosen bis 2030 in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP), online: Frankreich - relative Staatsverschuldung bis 2030| Statista
2 Siehe Transmission Protection Instrument (TPI) | Deutsche Bundesbank
3 Siehe S. 77 im sogenannten Draghi-Plan: Die Zukunft der europäischen Wettbewerbsfähigkeit. Teil A. Eine Strategie für die Wettbewerbsfähigkeit Europas, September 2024, Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union 2025, online: 97e481fd-2dc3-412d-be4c-f152a8232961_de
4 Siehe auch Norbert F. Tofall: Finanzielle Repression oder Geldreform? Was folgt aus den Staatsschulden in Deutschland, Europa und den USA? Kommentar zu Wirtschaft und Politik des Flossbach von Storch Research Institute vom 18. Juli 2025.
Rechtliche Hinweise
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen des Verfassers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Zukunftserwartung des Verfassers wider. Die Meinungen und Erwartungen können von Einschätzungen abweichen, die in anderen Dokumenten der Flossbach von Storch SE dargestellt werden. Die Beiträge werden nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Verfügung gestellt. (Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet). Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Eine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und Einschätzungen ist ausgeschlossen. Die historische Entwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Sämtliche Urheberrechte und sonstige Rechte, Titel und Ansprüche (einschließlich Copyrights, Marken, Patente und anderer Rechte an geistigem Eigentum sowie sonstiger Rechte) an, für und aus allen Informationen dieser Veröffentlichung unterliegen uneingeschränkt den jeweils gültigen Bestimmungen und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Sie erlangen keine Rechte an dem Inhalt. Das Copyright für veröffentlichte, von der Flossbach von Storch SE selbst erstellte Inhalte bleibt allein bei der Flossbach von Storch SE. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Inhalte, ganz oder in Teilen, ist ohne schriftliche Zustimmung der Flossbach von Storch SE nicht gestattet.
Nachdrucke dieser Veröffentlichung sowie öffentliches Zugänglichmachen – insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetauftritte – und Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Flossbach von Storch SE.
© 2025 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.