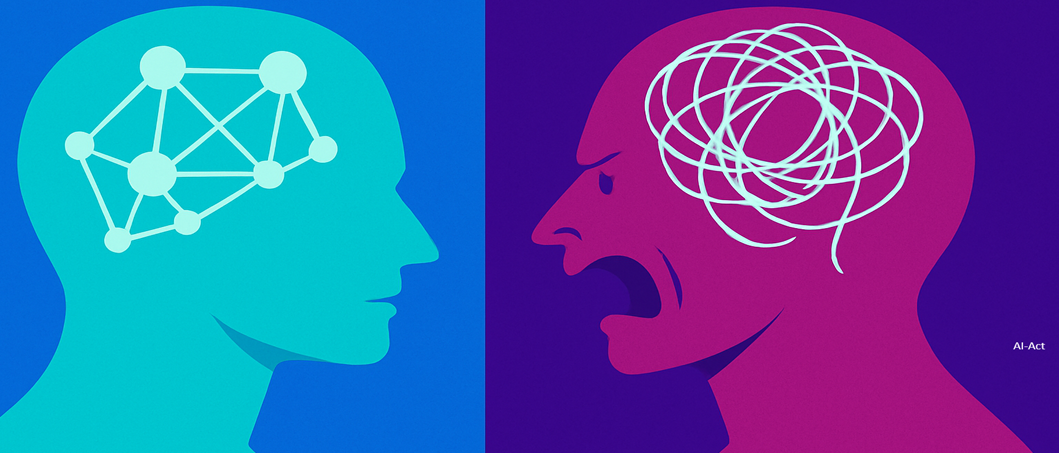KOMMENTAR. Verhaltensmuster prägen Anlageentscheidungen oft stärker als Fakten. Der Beitrag zeigt, wie künstliche Intelligenz Anlegern helfen kann, mit ihren Verhaltensmustern umzugehen.
Kaum fällt der Kurs einer Aktie, die man gerade gekauft hat, sucht man nach Gründen, warum die Kaufentscheidung richtig war. Leicht ist man dabei verleitet, die Informationen zu ignorieren, die den Kurs gedrückt haben.
Wem diese Situation bekannt vorkommt, der unterlag schon einmal dem Confirmation Bias. Dieser bezeichnet eines von vielen menschlichen Verhaltensmustern, für die private und institutionelle Investoren anfällig sind und die einen negativen Einfluss auf den Anlageerfolg haben können.
Es stellt sich die Frage, wie man sich schützen kann. Wir blicken in diesem Beitrag auf die gängigsten Verhaltensmuster, traditionelle Handlungsempfehlungen und analysieren, ob Künstliche Intelligenz (KI) helfen kann.
Was sind häufige Verhaltensmuster?
Der Begriff der Verhaltensmuster stammt aus der Verhaltensökonomie, die eine Synthese der Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie ist. Pioniere dieser Denkschule wie Daniel Kahneman und Amos Tversky (1979) sowie Richard Thaler (1980) zeigen, dass Menschen in ihren wirtschaftlichen Entscheidungen nicht immer rational agieren, wie es in der neoklassischen Denkschule angenommen wird. Kognitive Verzerrungen können Fehlentscheidungen verursachen, so dass es zu Ineffizienzen, Fehlbepreisungen und Preisblasen auf Finanzmärkten kommt.
Der Confirmation Bias beschreibtdie Tendenz, Informationen, die die eigene Überzeugung stützen, höher zu bewerten als Informationen, die ihnen widersprechen (Wason 1960, Nickerson 1998). Beispielsweise haben sich Anleger in den 2010er Jahren von der Darstellung der Wirecard AG als deutsches Tech-Wunder überzeugen lassen. Kritische Berichterstattung zu Bilanzunstimmigkeiten haben sie hingegen übergangen, oder als unbegründete Narrative der Shortseller abgetan. Viele hielten selbst nach den kritischen Veröffentlichungen der Financial Times im Jahr 2019 an ihrer Überzeugung fest und realisierten in Folge der Insolvenz erhebliche Verluste.
Von Fear of Missing out (FOMO) spricht man, wenn die Angst, etwas zu verpassen, bei einer Entscheidung stärker ins Gewicht fällt als die eigene fundierte Analyse. Sie lässt sich dem Verhaltensmuster des Herding (dt.: Herdenverhalten) zuordnen, umfasst jedoch zusätzlich das Empfinden von Knappheit und Angst (Gupta und Shrivastava 2021).
Insbesondere bei Spekulationsblasen kann FOMO eine Rolle spielen, wenn viele Investoren durch eine zu schnelle Ausweitung des Handelsvolumens (Overtrading) und Spekulation die Preise steigen lassen (Idris 2024). Beispielsweise führte die gute Performance von Tech-Werten im Jahr 2021 dazu, dass viele Anleger Tech-Werte kauften, da sie befürchteten, einen weiteren Preisanstieg zu verpassen. Jedoch brachen im sogenannten Tech-Winter des Jahres 2022 die Kurse vieler Tech-Werte ein, da der starke Preisanstieg auch durch die FOMO getrieben wurde.
Was können Anleger tun?
Einer der wichtigsten Ansätze zur Korrektur irrationaler Verhaltensmuster ist das Nudging(Thaler und Sunstein 2008). Darunter versteht man die Anpassung der Entscheidungsarchitektur, um das Verhalten ohne Zwang, Verbote oder finanzielle Anreize zu verändern. Dabei darf die Wahlmöglichkeit nicht eingeschränkt werden.
Ein Beispiel für Nudging in der Kapitalanlage ist bei der betrieblichen Altersvorsorge 401K in den USA zu finden (SECURE Act 2.0). Arbeitgeber melden ihre Arbeitnehmer automatisch für die betriebliche Altersvorsorge an. Wenn die Arbeitnehmer diese nicht wünschen, müssen sie ausdrücklich widersprechen. Der Gesetzgeber hat sich dabei das Verhaltensmuster der Loss Aversion zu Nutze gemacht: ein Verlust – d.h. die Entscheidung gegen die betriebliche Alterssicherung – wird höher als ein Gewinn in gleicher Höhe – d.h. in diesem Fall die Entscheidung für die betriebliche Alterssicherung – bewertet (Madrian und Shea 2001). Jedoch hemmt Nudging durch die Veränderung der Entscheidungsarchitektur den Lernprozess und die Kreativität, da dem Anleger die etwaigen besseren Optionen direkt angeboten werden (Rizzo und Whitman 2019).
Ein weiterer Ansatz, der sich aus dem kritischen Diskurs zum Nudging gebildet hat, ist das Boosting nachGrüne-Yanoff und Hertwig (2015). Es soll die Fähigkeit und Kompetenzen der Menschen stärken, bessere Entscheidungen treffen zu können. Menschen sollen nicht gelenkt, sondern befähigt werden. Boosting kann entweder darin bestehen, das Entscheidungsumfeld anzupassen, oder Strategien und Wissen zur Entscheidungsfindung zu erweitern. Während Nudging das Verhalten direkt beeinflussen will, setzt Boosting bei den individuellen Fähigkeiten an, mit bestimmten Situationen und Verhaltensmustern umzugehen. Dadurch bleiben Lernprozesse und Kreativität erhalten.
Eine Anwendung für Boosting für private und institutionelle Investoren ist ein Leitfaden für den Analyseprozess, der den Anwender an wichtige Faktoren für die Bewertung von Unternehmensanteilen erinnert. Eine ausformulierte Begründung einer Investitionsentscheidung sowie die Entwicklung von Gegenszenarien fördert die Reflexion der eigenen Entscheidungsfindung und Überzeugung, um beispielsweise dem Confirmation Bias entgegenzuwirken. Denn es müssen auch der eigenen Überzeugung widersprechende Informationen aktiv gesucht und ausgewertet werden.
Als dritte Handlungsmöglichkeit bietet sich eine automatisierte Geldanlage an. Durch die vollständige Abgabe der Kontrolle über die Investitionsentscheidungen an ein festes Regelwerk, entzieht man die eigene Entscheidungsfindung irrationalen Verhaltensmustern.
Auf Basis der Modern Portfolio Theory wird beispielsweise eine automatisierte aktive oder passive Investitionsstrategie erstellt, die zum Risikoprofil eines Anlegers passt. Allerdings ist man bei passiven Strategien, in der Regel ETFs, weiterhin Marktbewegungen ausgesetzt, die aus Verhaltensmustern wie FOMO oder Herding entstehen können. Bei automatisierten aktiven Strategien ist man wiederum den Verhaltensmustern derer ausgesetzt, die die aktive automatisierte Anlagestrategie erstellt haben.
Die KI als Hilfestellung?
KI kann bei der Implementierung von Nudging hilfreich sein, wie Hrnjic und Tomczak (2019) am Beispiel von Maschine Learning aufzeigen. Anstatt einheitliche Nudges für eine Gruppe von Anlegern oder Analysten vorzugeben, können Modelle entwickelt werden, die sich an den persönlichen Handlungsmustern der Nutzer ausrichten. Der negative Einfluss von Verhaltensmustern auf individueller Ebene wird mit Hilfe der KI abgemildert, so dass die Risiken irrationalen Verhaltens reduziert werden.
Durch Machine Learning-basierte Mustererkennung kann KI vergangene irrationale Anlageentscheidungen wie beispielsweise FOMO erkennen. Eine Benutzeroberfläche für eine Anlageentscheidung kann so gestaltet werden, dass dem Anleger automatisch relevante Informationen oder Vergleichsdaten präsentiert werden, die ihn unauffällig an seine bisherigen irrationalen Verhaltensmuster erinnern. So wird ein Bewusstsein geschaffen, ohne die Entscheidungsfreiheit einzuschränken. Der Anleger wird in Richtung einer reflektierten Entscheidung gelenkt.
Bei Investmentfirmen wird häufig als eine Form des Boostings ein strukturierter Entscheidungsprozess bei der Bewertung von Einzeltiteln vorgegeben. Ein KI-Agent, also ein autonomes Softwareprogramm, kann diesen Prozess begleiten, indem er den Analysten nicht nur zusätzliche Analysen liefert, sondern diese auch transparent erklärt. Durch die Aufbereitung der zugrunde liegenden Daten, das Aufdecken von Verhaltensmustern und das Aufzeigen alternativer Bewertungsansätze lernen Analysten, Chancen und Risiken systematischer zu erkennen. Die KI stärkt die Urteils- und Entscheidungskompetenz, sodass Analysten auch in zukünftigen Situationen ohne Unterstützung der KI bessere Bewertungen treffen können.
Zudem könnte im Sinne eines Boostings ein programmierter KI-Agent als eine Art Sparringspartner agieren, der dem Analysten in einem gesprochenen oder geschriebenen Dialog Gegenargumente aufzeigt. Die KI kann mehr Informationen zusammentragen und entsprechende Argumente liefern. Da der Nutzer aktiv gefordert ist, seine Entscheidung fachbezogen zu verteidigen, wird Reflektion gefördert und möglicherweise irrationale Verhaltensmuster aufgedeckt. Dieses Vorgehen ist besonders bei Overconfidence – die Tendenz von Menschen, ihre eigenen Fähigkeiten, ihr Wissen oder die Genauigkeit ihrer Einschätzungen zu überschätzen – sinnvoll.
KI-Systeme bieten auch Vorteile in der automatisierten Geldanlage, bei denen der Anleger die Kontrolle vollständig an ein Optimierungssystem abgegeben hat. Da KI-Systeme wesentlich mehr Informationen verarbeiten können, können sie Muster in Daten erkennen, die dem Menschen verborgen bleiben. Durch den Zugriff auf große und heterogene Datenmengen werden auch solche Informationen berücksichtigt, die den bestehenden Überzeugungen des Konstrukteurs des Automatisierungsalgorithmus widersprechen und die er gegebenenfalls auf Grund seiner Verhaltensmuster ansonsten nicht berücksichtigen würde. So wird die Wahrscheinlichkeit für einseitige, von Verhaltensmuster getriebene Entscheidungsprozesse reduziert.
Die Risiken von KI
Neben den allgemeinen Problemen wie Nachvollziehbarkeit, Erklärbarkeit und Datenqualität in der Entwicklung und Anwendung von KI, sind KI-Systeme nur beschränkt dazu geeignet, mit Verhaltensmustern umzugehen.
KI-Modelle werden anhand von Daten trainiert, die das Resultat menschlichen Handelns sind. Die Trainingsdaten sind damit das Ergebnis von menschlichen Verhaltensmustern. Es ist unklar, ob die Trainingsdaten um Verhaltensmuster korrigiert werden können, um eine „unverzerrte Datengrundlage“ zu erhalten. Sowohl die Identifikation eines Verhaltensmusters als auch die Definition eines „unverzerrten Zustandes“ obliegen der subjektiven Einschätzung des KI-Entwicklers.
KI-Modelle können deshalb auch keine objektive Auswertung von Informationen im Sinne eines rationalen Modells garantieren. Denn sie sind in ihrer Zuverlässigkeit und Genauigkeit direkt von den Spezifikationen des Konstrukteurs, von Geschäftsinteressen und dem praktischen Einsatz des Nutzers abhängig. Wenn beispielsweise ein KI-Ingenieur anfällig für den Confirmation Bias und daher von der Bedeutung einer bestimmten Variable für einen Zusammenhang überzeugt ist, kann sein Modell suboptimale Handlungsempfehlungen vorschlagen oder gar Schaden verursachen.
Fazit
In der Verhaltensökonomie gibt es bei Entscheidungen irrationale Verhaltensmuster, die von einem modellbasierten rationalen Handeln abweichen. Ob die modellbasierte “unverzerrte” Alternative wirklich darstellbar ist, ist ungewiss. Dem entsprechend sind Handlungsempfehlungen bei Verhaltensmustern stets mit Vorsicht zu betrachten, da sie menschliche, meist intuitive Handlungen abändern, jedoch ungewiss bleibt, ob die Alternativ tatsächlich „besser“ ist.
Die Österreichische Schule der Nationalökonomie geht hingegen davon aus, dass Anleger in ihrer eigenen Sichtweise stets rational handeln, welches als subjektive Rationalität bezeichnet wird (Mieses 1949). Verhaltensmuster sind demnach ein natürlicher Teil des menschlichen Handelns und können aus dieser Sicht nicht von vornerein negativ beurteilt werden, auch wenn sie in der Geldanlage nachteilige Folgen haben können.
Anleger unterliegen demnach einem ständigen Lernprozess, so dass es in ihrem Interesse ist, den eigenen Lernprozess zu verbessern, indem sie sich kontinuierlich mit den eigenen Verhaltensmustern auseinandersetzen. KI-Ansätze bieten Chancen Verhaltensmuster und deren Folgen besser zu identifizieren, sind aber von Limitationen in Datenqualität, Anpassungsfähigkeit und Wirksamkeit gekennzeichnet. KI kann damit zwar wertvolle Unterstützung leisten, ist jedoch kein Allheilmittel im Umgang mit irrationalen Verhaltensmustern in der Geldanlage.
Wer seine Verhaltensmuster kennt, sie reflektiert und bewusst in seine Entscheidungen einbezieht, stärkt seine Selbstbestimmung. Eigenverantwortliches Handeln bedeutet dabei nicht, jedes Verhaltensmuster auszuschalten, sondern es als Teil des eigenen Entscheidungsprozesses zu akzeptieren und konstruktiv zu nutzen. Diesen Prozess kann die künstliche Intelligenz nicht ersetzen, sie kann aber ein Hilfsmittel sein.
Literatur
Gupta, Shilpi, and Monica Shrivastava. 2021. “Herding and Loss Aversion in Stock Markets: Mediating Role of Fear of Missing out (FOMO) in Retail Investors.” International Journal of Emerging Markets 17 (7): 1720–37. https://doi.org/10.1108/IJOEM-08-2020-0933.
Grüne-Yanoff, Till, and Ralph Hertwig. 2016. “Nudge versus Boost: How Coherent Are Policy and Theory?” Minds and Machines 26: 149–83. https://doi.org/10.1007/s11023-015-9367-9.
Hrnjic, Emir, and Nikodem Tomczak. 2019. “Machine Learning and Behavioral Economics for Personalized Choice Architecture.” ArXiv (Cornell University). https://doi.org/10.48550/arxiv.1907.02100.
Idris, Hariany. 2024. “The Effects of FOMO on Investment Behavior in the Stock Market.” Golden Ratio of Data in Summary 4 (2): 879–87. https://doi.org/10.52970/grdis.v4i2.757.
Kahneman, Daniel, and Amos Tversky. 1979. “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk.” Econometrica 47 (2): 263–92. doi.org/10.2307/1914185.
Madrian, Brigitte C., and Dennis F. Shea. 2001. “The Power of Suggestion: Inertia in 401(K) Participation and Savings Behavior.” The Quarterly Journal of Economics 116 (4): 1149–87. https://doi.org/10.1162/003355301753265543.
Mises, Ludwig von. 1949. “Human Action - a Treatise on Economics.” 1st ed. Auburn, USA: The Ludwig von Mises Institute.
Nickerson, Raymond S. 1998. “Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises.” Review of General Psychology 2 (2): 175–220. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.2.175.
Rizzo, Mario J, and Glen Whitman. 2019. “Escaping Paternalism.” Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
Thaler, R. (1980). “Toward a positive theory of consumer choice.” Journal of Economic Behavior and Organization, 1(1), 39–60. https://doi.org/10.1016/0167-2681(80)90051-7
Thaler, Richard H, and Cass R Sunstein. 2008. “Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness.” London, UK: Penguin Books.
Wason, Peter. 1960. “On the Failure to Eliminate Hypotheses in a Conceptual Task.” Quarterly Journal of Experimental Psychology 12 (3): 129–40. https://doi.org/10.1080/17470216008416717.
Rechtliche Hinweise
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen des Verfassers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Zukunftserwartung des Verfassers wider. Die Meinungen und Erwartungen können von Einschätzungen abweichen, die in anderen Dokumenten der Flossbach von Storch SE dargestellt werden. Die Beiträge werden nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Verfügung gestellt. (Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet). Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Eine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und Einschätzungen ist ausgeschlossen. Die historische Entwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Sämtliche Urheberrechte und sonstige Rechte, Titel und Ansprüche (einschließlich Copyrights, Marken, Patente und anderer Rechte an geistigem Eigentum sowie sonstiger Rechte) an, für und aus allen Informationen dieser Veröffentlichung unterliegen uneingeschränkt den jeweils gültigen Bestimmungen und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Sie erlangen keine Rechte an dem Inhalt. Das Copyright für veröffentlichte, von der Flossbach von Storch SE selbst erstellte Inhalte bleibt allein bei der Flossbach von Storch SE. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Inhalte, ganz oder in Teilen, ist ohne schriftliche Zustimmung der Flossbach von Storch SE nicht gestattet.
Nachdrucke dieser Veröffentlichung sowie öffentliches Zugänglichmachen – insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetauftritte – und Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Flossbach von Storch SE.
© 2026 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.